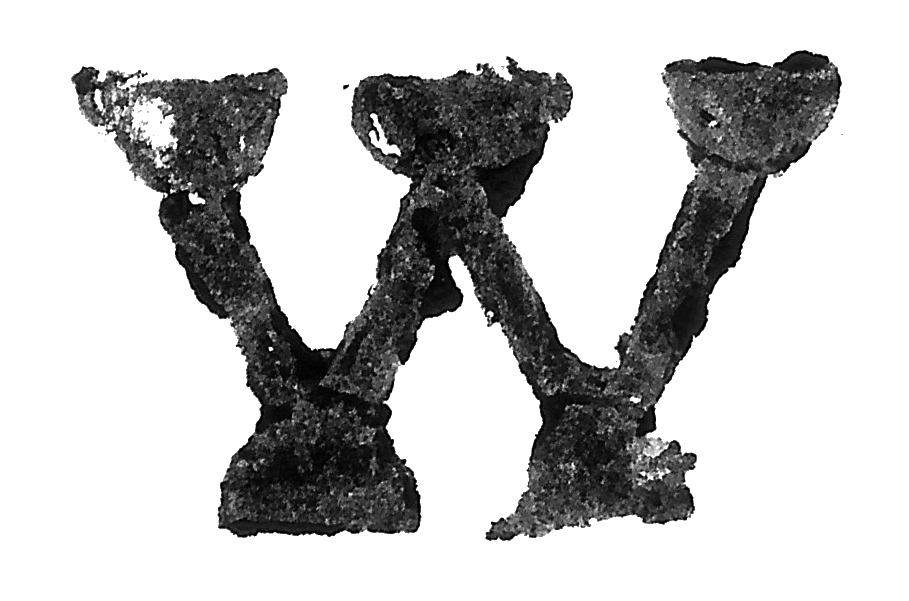Unsicherheit aushalten: Das Diskutieren von fiktiven Texten über Diskriminierung
Frisches Eis im Eisstadion in Oberstdorf
Texte entstehen in Einsamkeit am Schreibtisch, beim Baden, beim Spazierengehen, beim Musikhören und manchmal im Austausch. Für Texte über Diskriminierung brauche ich einen Schallraum, in den ich sie hineinlese, um diverse Reaktionen dazu kennen zu lernen, und an den Texten entsprechend weiterzuarbeiten. Subtiler, vager, provokativer, ich passe den Wortlaut an, schließe vielleicht manche vom Zugang zu den Texten bewusst(er) aus, hole wiederum manche besser ab.
Durch den Austausch werden diese Texte wirkungsvoller, davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig verhandle ich in ihnen Themen, die mir persönlich unter die Haut gehen, aus eigener Erfahrung, und ich möchte so offen sein, wie ich kann, für Unverständnis, für Irritation und das Moralisch-überlegen-sein-Wollen seitens derjenigen, die diese Erfahrungen nicht teilen. Das bedeutet, wenn ich an meinen Texten im Austausch arbeite, begebe ich mich willentlich in einen für mich selbst unsicheren Schallraum. Ein Umstand, mit dem ich mich fortwährend auseinander setzen muss.
Ein Beispiel für einen solchen Schallraum wäre dieser Artikel: Ich setze dir Arbeitsthesen vor die Nase, in der Hoffnung darauf, einen Dialog anzuregen. Diese Thesen werden dich vielleicht aufregen, das ist in Ordnung. Ich möchte dich einladen, dich selbst dabei zu beobachten, und mit einem Urteil bis zum Schluss zu warten. Ich setze voraus, dass du diesem Text und deinen Mitmenschen gegenüber wohlwollend eingestellt bist, dass du in deinem Denken und Handeln Menschen nicht bewusst auf eine diskriminierende Art ausschließen willst. Das setze ich jedes Mal voraus, wenn ich solche Schallräume schaffe. Naiv von mir? Vielleicht.
Vom „Mut“ etwas nicht zu wissen
Es ist schon faszinierend, wie Texte besprochen werden, in denen politisch instrumentalisierte Themen verhandelt werden. Ich denke da in etwa an die aktuell wieder geführten Diskussionen rund um trans Personen im Sport, bei denen seit Jahrzehnten dieselben Argumente wiedergekäut werden. Dass ich diese Diskussionen auf dem Radar habe, könnte „rein zufällig“ etwas damit zu tun haben, dass ich einen Roman über eine trans Person im Leistungssport schreibe. In den Räumen, in denen ich mich aufhalte, scheinen die meisten gewillt zu sein, trans Personen einzuschließen (bare minimum, aber leider nach wie vor keine Selbstverständlichkeit), was nicht automatisch bedeutet, dass alle zum Beispiel wissen, warum es denn nicht „ganz einfach“ sei, den Geschlechtseintrag in Ausweisdokumenten zu verändern oder „wie das denn jetzt ist, mit Hormonen und OPs und athletischer Leistungsfähigkeit und so“. In einer Schreibwerkstatt danach zu fragen, könnte allerdings als transphob und ignorant gedeutet werden. Wenn dieses Nachfragen verurteilt wird, erfolgt es womöglich auf eine Art, die die Möglichkeit ausschließt, Sachverhalte zu erklären: „Wie, du weißt es nicht? Ja, sag mal, lebst du hinter dem Mond, oder was?“
Ich möchte, dass Raum für womöglich ignorante Fragen in diesen Kontexten da ist. Ich möchte auch, dass Raum für Fragen an meinen Roman da ist, die im Alltag übergriffig wären („Ja, was für einen Körper hat denn jetzt deine Hauptfigur?“), damit ich mir wiederum darüber Gedanken machen kann, inwiefern ich Antworten auf diese Fragen innerhalb des Textes geben will. Das bedeutet nicht, dass diese Fragen nicht triggern. Das bedeutet nicht, dass ich bereit bin, lächelnd auszuholen und einen Abriss zum Transsexuellengesetz und struktureller Transphobie in Sportorganisationen zum Besten zu geben. Das bedeutet, dass ich manchmal baff den Mund auf- und zuklappe und entweder in eine emotionale Lähmung verfalle, aus der heraus ich überhaupt nichts mehr um mich herum aufnehmen kann, oder forsch abblocke.
Und dennoch ist es mir wichtig, dass diese Fragen gestellt werden können. Denn die meiste Zeit traut sich niemand, sie zu stellen, somit bleibt das Unwissen. Dieses Schweigen kommt für mich dem Schweigen nahe, wenn man als Ally diskriminierendem Verhalten in Alltagssituationen nichts entgegen setzt, vorbei läuft, um sich dann in der peer group darüber auszutauschen, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen habe, weil man nichts gesagt hätte, und dieses schlechte Gewissen mache doch einen wiederum zu einem guten Menschen, oder? Ähm, nö.
„Diskriminierung erkennen“ bedeutet nicht „dagegen vorgehen“
Ich habe das Gefühl, dass bei fiktiven Texten, die von Diskriminierung handeln, es bei deren Besprechung oftmals nicht um die Texte an sich geht, sondern um ihre (unterstellte?) Positionierung und die eigene Positionierung zu dieser Positionierung. Manchmal wird es zu einem Wettbewerb: Wer spricht als erstes an, dass es problematisch ist? Wer erkennt es und wer nicht? Und wenn man nicht schnell genug verurteilt … nun, dann wird dieses Ausbleiben einer Stellungnahme verurteilt. Wenn es aber in den Texten etwa darum geht, reproduzierte Diskriminierung unter den Menschen darzustellen, die die besten Inklusionsabsichten verfolgen, wäre es fehl am Platz das auf überhebliche Art anzuprangern.
Ein Text über eine zum Beispiel misogyne Figur ist nicht zwangsweise misogyn. Indem man mit dem Finger auf die Figur zeigt und anmerkt, das ginge ja so nicht, mag man sich für einen Moment gut fühlen, weil: man hat es ja erkannt, man hat es ja benannt, aber eine Auseinandersetzung mit dem Text und somit auch mit dem Thema findet bei diesem Erkennen und Benennen nicht statt. Wenn unsere Beschäftigung mit Diskriminierung damit endet, dass wir Verhalten mit Labels wie „rassistisch“, „queerphob“, „ableistisch“, „misogyn“, „antisemitisch“ versehen, kommen wir nicht weiter. Die Benennung sollte lediglich ein möglicher Anfang einer Auseinandersetzung sein.
Senka mit 5 Jahren im Akrobatik-Training
Wenn ich auffordere, genauer hinzuschauen, reagieren manche gereizt, in etwa: „Aber ich weiß doch, dass das rassistisch ist, ich habe es doch erkannt, was willst du mehr von mir?“ Das Erkennen löst das Problem nicht. Dass wir uns sicher in unserem Urteil fühlen, löst das Problem nicht. Auch wenn wir schweigen, aus Angst, etwas Falsches zu sagen und von anderen für Unwissen verurteilt zu werden, … löst es das Problem nicht.
Ein Spektrum schaffen zwischen „verurteilen“ und „verurteilt werden“
Ich möchte im Schreiben Erfahrungen Raum geben, auf eine Weise, die anregt, nicht darüber zu urteilen, sondern erstmal zur Kenntnis zu nehmen, genauer hinzuschauen. Das bedeutet auch, dass ich Leser:innen auffordern möchte, den Impuls, ein Urteil zu fällen, um sich auf der sicheren, „guten“ Seite zu wähnen, zu unterdrücken, also auch die eigenen Normvorstellungen zu hinterfragen. Das ist viel verlangt, ich weiß. Das Aushalten eines moralischen Schwebezustands ist schwer, also auch: das Aushalten der eigenen Wissenslücken und der Möglichkeit, dass man zum Schluss eben doch falsch liegen könnte. Angenommen, ich fange einen Roman an, in dem es um eine sich rassistisch verhaltende Figur geht, ich rege mich über sie auf, ich profiliere mich durch einen Buch-Rant auf Social Media in meiner Bubble als besonders aufgeklärt, und dann stelle ich auf Seite 150 fest, dass in dem Roman strukturelle Verstrickungen reflektiert und kritisiert werden, die diese Figur prägen… Vorausgesetzt natürlich, ich habe den Roman bis dahin noch nicht entnervt zugeklappt, denn im Alltag würde ich mich nicht stundenlang dem Gespräch mit einer rassistischen Person aussetzen wollen. Wenn mich der Roman auf diese Weise triggert, frage ich mich, ob er für mich (aka „Person mit Migrationshintergrund“, hüstel) geschrieben ist. Ich beantworte die Frage provisorisch mit Nein.
Für einen Rant braucht es übrigens auch Ressourcen und eine Sicherheit, die mir oftmals fehlt. Ich bin es gewohnt, mich zu fragen: Ist es dieses Mal vielleicht ein Mal „zu viel“, dass ich über trans Personen und Migration spreche? Nerve ich damit? (Es gibt kein „zu viel“, bashe ich mich selbst, das ist internalisierter Schmarrn, entlerne ihn doch endlich mal.) Der Wunsch, nicht „zu viel“ über etwas zu reden und auch im Recht und aufgeklärt zu sein, von der eigenen peer group anerkannt und gelobt zu werden, also auch zu wissen, was in dieser peer group als schlecht gilt – all das sind soziale Erwartungen, die sicherlich ihre Berechtigung haben, aber eben relativ sind. Was als gut und schlecht gilt, als politisch korrekt und unkorrekt, ist kulturell bedingt und wandelbar, es lässt Raum für Weiterentwicklung. Aber diese Weiterentwicklung ist nur dann möglich, wenn wir bereit sind, die eigenen Urteile zu hinterfragen, sie zurückzuhalten, auch wenn Zweifel als Zeichen des Unmoralischen gedeutet werden könnten. Das bedeutet auch: nicht zu verurteilen, wenn jemand zweifelt und sich (noch) nicht positionieren kann oder will. Und hoffentlich auch: ein Wegkommen von binären Vorstellungen moralischer Überlegenheit.
Dieser offene Raum macht was mit mir.
Wenn ich mich mit einem Thema in einem literarischen Text in den Raum stelle, möchte ich damit also auch einen sicheren Raum für Unsicherheiten aufmachen, auch von den Menschen, die Diskriminierungserfahrungen meiner Figuren nicht unmittelbar aus ihrem eigenen Leben kennen. Damit öffne ich – wie gesagt – auch bewusst einen Raum, der für mich selbst unsicher ist, also Raum für Anmerkungen oder Fragen, die mich triggern könnten. Ich habe einen Anspruch an mich selbst, sachlich zu erklären, wenn etwas für Verwirrung sorgt, aber ich scheitere regelmäßig daran. Die Anmerkungen machen etwas mit mir. Sie sind ein hourly reminder: Hey, das ist nur ein Tropfen an wohlmeinendem Unwissen in einem System, das nicht für Menschen wie dich gestaltet wurde (bedeutet dieses Unwissen auch unbewusst Kompliz:in mit diesem System sein?). Ich bedanke mich für die Anmerkungen, ich bedanke mich für die Fragen, denn ich wollte ja den Raum dafür öffnen. Ich gehe nach Hause, ich habe keinen Appetit, ich kann nicht schlafen, ich kann mich nicht konzentrieren, mein Magen spinnt, mein Kreislauf auch, das macht nichts, das bin ich gewohnt, das wird vergehen. Bis es vergeht, schließe ich diesen Raum.
Wenn ich daran weitergrübele, lande ich irgendwann bei dem Gedanken, dass wir Lernräume brauchen, wo es explizit erwünscht ist, dass unbewusste Vorurteile und diskriminierende Verhaltensweisen sichtbar zu Tage treten dürfen, um sich mit diesen kritisch auseinanderzusetzen. Was allerdings nicht gleichbedeutend ist mit einer Forderung nach mehr Raum für Diskriminierung im Allgemeinen.
Wer wird es „wirklich“ checken?
Wenn ich mich mit Diskriminierung in fiktionalen Texten auseinander setze und diese Texte in den Raum stelle, gibt es Menschen in diesem Raum, die vergleichbare Erfahrungen wie meine Figuren gemacht haben, und Menschen, die sie nicht gemacht haben. Manchmal besprechen sie die Texte so, als hätten sie jeweils zwei völlig unterschiedliche Fassungen davon gelesen. Dass Lesende Erfahrungen mit den Figuren teilen, ist keine Garantie dafür, dass sie den Text verstehen – daran versuche ich mich zu erinnern, wenn ich das Gefühl habe, dass nur sie den Text „wirklich“ verstehen können, was auch immer das heißen mag.
Archivmaterial: Eiskunstlauf 1936 in Hanover, New Hampshire
Auch Personen, die die dargestellte Diskriminierung erfahren haben, können mit internalisierten Verhaltensmustern Diskriminierung reproduzieren. Ich glaube allerdings, dass Menschen, die eben diese Erfahrungen selbst nicht gemacht haben, eher unter Druck stehen oder sich selbst unter Druck setzen, „nichts Falsches“ dazu zu sagen, um nicht zu verletzen, um von den anderen nicht verurteilt zu werden. Der einfachste Weg damit umzugehen ist zu schweigen. Aber das Schweigen bringt mir nichts. Denn ich will ja Feedback zum Text. Ich möchte einschätzen können, wie er wirkt, welche Fragen er aufwirft, wo ich Stellen präzisieren muss (um eventuell für ein bisschen mehr Verwirrung zu sorgen).
Wut outsourcen
Ich brauche Feedback zu meinen Texten, stattdessen navigiere ich Unsicherheiten und Verwirrung von anderen und merke dabei, wie ich als Person mit eigenen Erfahrungen außen vor bleiben möchte, und nicht viszeral auf übergriffige oder naive und ehrlich an einer Antwort interessierte Fragende reagieren. Ich reagiere natürlich trotzdem, verdränge aber den bewussten Umgang damit. Das heißt: Meistens reagiere ich körperlich, aber nicht emotional. Andere Menschen werden an meiner Stellen wütend, wenn ich ihnen später von den Fragenden erzähle. Ich bin dankbar für ihre Wut, aber ich kann sie mir selbst dennoch nicht erlauben. Wahrscheinlich weil ich die Vorstellung eines „adäquaten Umgangs mit Idiot:innen“ aus den einzelnen Communities internalisiert habe, die wiederum als Bewältigungsstrategie sich angewöhnen mussten, diskriminierende Übergriffe „nicht zu persönlich zu nehmen“, weil man ansonsten psychisch mit dem Schwall nicht umgehen könnte. Sidenote: Manche Kommentare sind nicht inhaltlich triggernd, sondern wegen ihrer Quantität und weil jede Person, die sie macht, davon überzeugt ist, die erste Person zu sein, der es in den Sinn kommt, das anzumerken. Dann reagiere ich nicht unmittelbar auf die zigste Person, sondern auf all die Male davor, die sich mein Körper gemerkt hat.
Ich trage die Gespräche in meinem Körper, bei denen mir zum Beispiel Personen aus meinem Herkunftsland gesagt haben: „Ach, ja, der Nachbar, der deine Mutter wieder antislawistisch beschimpft hat, der ist halt blöd, mei. Denk‘ dir nichts dabei, vergeude deine Energie nicht. Es gibt nur eine adäquate Art damit umzugehen: mit den Schultern zucken und weiterleben.“ Mein Bauch bläht sich vor heruntergeschluckten Worten, mir tun die Schultern weh vom Zucken, aber diese Gesten verlerne ich nicht von heute auf morgen.
Ich höre mir an, dass ich das nicht machen müsse, dieses Erklären, dieses sich Aussetzen, dieses Räume-Öffnen, dass das nicht meine Verantwortung sei, und ich weiß, dass es gut gemeint ist. Aber ich mache das aus völlig egoistischen Gründen: Ich brauche Feedback, ich brauche Unterstützung, und manchmal kann ich sie nur kriegen, wenn ich vorab bestimmte Dinge klar stelle. Wenn ich eben doch erstmal aushole und erläutere, was es mit gesetzlichen Regelungen für die Veränderung des Geschlechtseintrages in unterschiedlichen Ländern auf sich hat. Die Frage für mich ist dann nicht, ob ich überhaupt erkläre, sondern wann ich mich dafür stabil genug fühle, und ob die Menschen, mit denen ich spreche, offen wären, die eigenen Urteile zu hinterfragen. Ich leiste also einen Vertrauensvorsprung, um nachzufühlen: War er gerechtfertigt oder nicht? Erst wenn ich auf Widerstand stoße, merke ich: In diesem Raum ist gerade Aufklärungsbedarf. Und manchmal stoße ich auf eine solche Art darauf, dass mir klar wird: Hier ist es derart unsicher, das willst du dir nicht antun. Dann bedanke ich mich und wechsle nach Möglichkeit das Thema.
Mehr Raum für die Ängste von Unterstützenden
Ich wünsche mir mehr Räume für Allys, in denen sie über ihre Ängste und Unsicherheiten sprechen können, auf die sie stoßen, wenn sie sich für jemanden einsetzen, deren Erfahrungen sie nicht teilen. Ich wünsche mir mehr solcher Räume, aber ich will mich nicht in diesen Räumen aufhalten. Die Unsicherheiten, die darin besprochen werden, entstammen demselben verkorksten, gefährlichen System, aus dem auch meine Unsicherheiten stammen, aber es ist eine Art Mini-Dosis, auf die Allys verzichten können, jederzeit.
Ihr Engagement rührt von einem moralischen Pflichtbewusstsein. Meins aus einer existenziellen Notwendigkeit. Noch während ich das denke, kommt mir mein Gehabe viel zu polemisch vor, aber was soll’s? (Ich habe Vorurteile gegen Polemik.) Was ich sagen will, ist: Ich sehe ihre Unsicherheiten, ich schätze sie, ich bin dafür dankbar, dass es überhaupt Menschen gibt, die einen Notstand ansprechen, auch wenn es sie nicht unmittelbar betrifft. Aber ich kann ihre Ängste nicht immer on top zu meinen eigenen moderieren. Genau das muss ich aber jedes Mal tun, wenn ich über Diskriminierung schreibe und an meinen Texten im Austausch weiterarbeiten will.
Und besonders widerborstig ist die Moderation der Unsicherheiten von denjenigen, die sich sicher in ihrem Urteil fühlen, die sich zu den „Guten“ zählen, die theoretische Begriffe als Vorwürfe an andere wie ein Schutzschild vor sich tragen. (Ich habe auch Vorurteile gegen akademische klassistische Diskurse.) Wer auf das diskriminierende Verhalten von anderen hinweist, wertet die eigenen Äußerungen damit nicht auf. Und dieses profilierende Hinweisen blockiert manchmal eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Diskriminierung. Ich habe noch keine Lösung dafür, aber ich frage mich, ob andere Schreibende ähnliche Erfahrungen machen. Derweil öffne und schließe ich weiterhin Räume mit Texten und bedanke mich für jede Anmerkung.